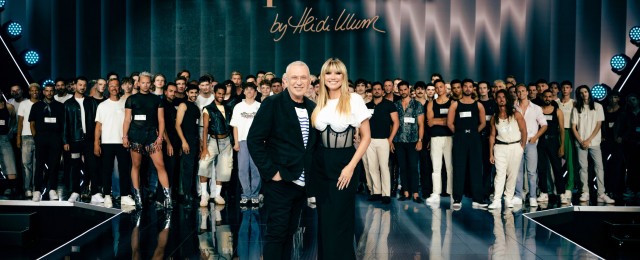Folgeninhalt
Am Ende des Zweiten Weltkriegs verlieren zwölf Millionen Deutsche ihre Heimat - in den ehemaligen Ostgebieten und in Siedlungsgebieten in Südosteuropa, in denen Deutsche oft seit Jahrhunderten ansässig waren. Sie alle müssen sich nach dem Krieg ein neues Zuhause zu suchen - viele kommen in den Südwesten. Da die französische Besatzungsmacht sich weigert, in ihrer Zone Flüchtlinge und Heimatvertriebene aufzunehmen, landen die meisten in den amerikanisch besetzten Gebieten von Württemberg und Baden. Die Amerikaner hatten verfügt, dass sie überwiegend in ländlichen Gebieten unterzubringen seien. Hier, so hoffen die Besatzer, sei es leichter als in den zerstörten Städten, die Menschen mit einem Dach über dem Kopf und Lebensmitteln zu versorgen. Und so müssen viele Gemeinden und kleinen Städte Platz schaffen für die Heimatlosen. Oft steigt die Einwohnerzahl innerhalb weniger Monate um mehr als 50 Prozent an. Konflikte bleiben da nicht aus. "Begeistert waren wir nicht", sagt eine Einheimische, aber auch sie musste Flüchtlinge aufnehmen. Der Film erzählt von der Mühsal des Neubeginns, von der existentiellen Not jener Jahre aber auch von den kulturellen Schwierigkeiten, die sich aus massenhafter Flucht und Vertreibung ergeben: Die ZeitzeugInnen berichten vom Trauma der Flucht und der Vertreibung, von Hunger und begrenzten Wohnmöglichkeiten, von Ablehnung durch die Einheimischen, vom mühsamen Erwerb schwäbischer Sprachkenntnisse. "Ich habe meine Mutter gefragt: Sind wir hier noch in Deutschland?" So beschreibt Christa Kaschek im Film ihre ersten Eindrücke von der neuen Umgebung auf der Schwäbischen Alb, wohin ihre Familie aus Schlesien geflüchtet war. Und es sollte noch Jahre dauern, bis sich die Familie einleben konnte, der Vater Arbeit fand und die Familie wieder ein eigenes Dach über dem Kopf hatte. Oft war es entscheidend, dass sich Einheimische für das Schicksal der "Reingeschmeckten" interessierten und sich für sie engagierten. In Hettingen, einem kleinen Dorf bei Buchen war es der Dorfpfarrer Heinrich Magnani, der sich um die Flüchtlinge und Vertriebenen kümmerte. Er sorgte für die Unterbringung und er war es, der bereits 1946 den Bau einer Flüchtlingssiedlung initiierte, deren Architekt kein Geringerer war, als der später berühmte Egon Eiermann. Der Film zeigt, wie wichtig in den ersten Jahren auch die Arbeit der Wohlfahrtsverbände war, die eine Flüchtlingsseelsorge und -Fürsorge aufbauten. Wie notwendig allein die Kleidersammlungen waren, aus denen manch ein gebrauchtes Stück verteilt werden konnte, berichtet zum Beispiel Ursula Kwapil, eine ehemalige Mitarbeiterin der Caritas, die selbst ihre schlesische Heimat überstürzt hatte verlassen müssen. Dass letztlich die meisten eine neue Heimat gefunden haben, dass die Integration nach mühseligen Anfängen geklappt hat, zählt bis heute zu den großen Leistungen der jungen Bundesrepublik.
(SWR)