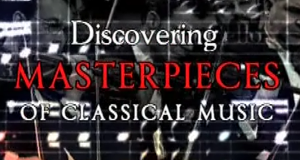Folgeninhalt
Das starke Stück: Tschaikowskys 5. Sinfonie. "Nach jeder Aufführung komme ich immer mehr zu der Überzeugung, dass meine letzte Sinfonie ein misslungenes Werk ist....Es hat sich herausgestellt, dass sie zu bunt, zu massig, zu unaufrichtig, zu lang, überhaupt wenig ansprechend ist. Sollte ich mich schon ausgeschrieben haben? Sollte wirklich schon der Anfang des Endes begonnen haben?" Im Dezember 1888 schreibt Peter Tschaikowsky diese Zeilen an seine Brieffreundin Nadeshda von Meck. Gemeint ist seine 5. Sinfonie, die "Schicksals-Sinfonie", der musikalische Spiegel einer krisendurchbebten Zeit. Ist wirklich schon der Anfang des Endes über den 48-jährigen Komponisten hereingebrochen? Aus künstlerischer Sicht befindet sich Tschaikowsky auf der Höhe seines Erfolgs. Als Dirigent ist er international gefragt, seine Kompositionen werden von Publikum und Kritik endlich anerkannt. Seelisch aber schwankt er zwischen Höhenflügen und tiefer Verzweiflung. Seine drei letzten Sinfonien versieht er mit persönlichen Kommentaren, einer Art psychologischem Programm. Ebenso wie in der 4. stellt Tschaikowsky auch seiner 5. Sinfonie ein tönendes Signum des Schicksals voran, das alle vier Sätze durchzieht. Der Komponist kommentiert dieses Schicksalsmotiv als "Vollständiges Sich-Beugen vor dem Schicksal oder was dasselbe ist, vor dem unergründlichen Walten der Vorsehung." Der lettische Dirigent Andris Nelsons berücksichtigt in seiner Interpretation zwar Tschaikowskys persönliche Notiz, weist aber über sie hinaus. "Das ist vorbei, dass man sagt, in der 4. symphonie meint er das schicksal, in der 5. auch und die 6. ist dann das Requiem. Aber ich denke so ist es nicht. In seinem Leben gabs wie bei jedem unterschiedliche Momente und Gefühle. Ich glaube, es ist am besten nicht alles in Worte zu zwängen und zu erklären. Er wollte im grunde nicht genau sagen, worum es in dieser Musik geht, gut einiges hat er aufgeschrieben, aber Musik ist eben mehr als eine Notiz." (Andris Nelsons) Gleich zu Beginn der Sinfonie stellt Tschaikowsky das Schicksalsthema vor, intoniert von den Klarinetten, zum Klang der tiefen Streicher. Die düstere e-moll Stimmung, gleicht dem Schatten der Vorsehung. Obwohl dieses Motiv die gesamte Sinfonie dominiert und in allen Sätzen präsent ist, ist es weder ein Erinnerungsmotiv noch eine Ideé fixe. Tschaikowsky gibt vielmehr schon mit den Anfangstakten die auswegslose Grundstimmung vor, die unausweichlich in der Erfüllung des Schicksals im letzten Satz gipfelt. Oder anders: Von vornherein gibt es kein Entrinnen. Beschwingte oder aufbrausende Abschnitte sind lediglich retardierende Momente. "Dynamit: Den langsamen Satz überschreibt Tschaikowsky mit der Frage 'Soll man sich dem Glauben in die Arme werfen?' Melancholische Schönheit, und eine schwerelose Klarinettenmelodie, die zu versprechen scheint, dass alles gut wird. Fast ist alles gut, dann bricht das Schicksalsthema ein." (Andris Nelson während einer Probe)
(ARD-alpha)