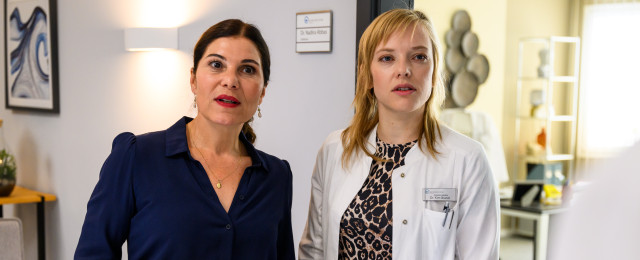Folgeninhalt
Die Dokumentation zeigt, wie Wissenschaftler, die in ihrer Kindheit zu begeisterten Zuschauern der "Star Trek"-Filme und -Serien gehörten, heute die für diese Fiktionen entworfenen Zukunftsvisionen mit eigenen Ideen übertreffen, sei es auf dem Gebiet der Mobiltelefone und des Computers oder mit bedeutenden Innovationen in der Medizin. So war zum Beispiel Marc Rayman in den 60er Jahren als kleiner Vorstadtjunge fasziniert von der Fernsehberichterstattung über das erste bemannte Raumfahrtprogramm "Mercury" und von den parallel laufenden "Star Trek"-Expeditionen. Er schlug eine Karriere ein, die ihn bis zum verantwortlichen Chefingenieur für das Raumsondenroboter-Projekt "Deep Space" am Jet Propulsion Laboratory der NASA führte. Die Anziehung zwischen "Star Trek"-Fans und der NASA ist eine gegenseitige. So wurde die allererste Weltraumfähre der NASA "Enterprise" getauft. Und einige junge "Star Trek"-Fans interessierten sich so sehr für die technischen Spielereien an Bord der Raumfähre im Jahr 2300, dass sie es zu ihrer Lebensaufgabe machten, diese Apparaturen von der Leinwand in den Alltag zu bringen. Beispielsweise erkannte Marty Cooper, Chefingenieur bei Motorola, dass die Menschheit von Natur aus mobil ist und nicht durch herkömmliche Festnetztelefone an Schreibtische gefesselt sein möchte. Inspiriert von dem schnurlosen "Kommunikator" mit Spracherkennung aus "Star Trek" erfanden Cooper und seine Kollegen das erste Mobiltelefon und setzten damit eine Revolution im Bereich der Telekommunikation in Gang. Und Seth Shostak, Chefastronom am SETI-Institut, führt das wissenschaftliche Engagement für die Suche nach außerirdischem Leben zu einem großen Teil auf das durch die "Star Trek"-Filme geweckte Verlangen zurück, den Rest des Universums kennen und verstehen zu lernen. Deutliche Einflüsse der Serie sind auch in der Entwicklung von Computern, Mikrochips und Softwareprogrammen zu erkennen, vom primitiven "Altair 8.800" - der nach einem Sonnensystem aus "Star Trek" benannt wurde - und seiner Weiterentwicklung zum ersten Apple-Computer bis zum Erfolg von Bill Gates und Microsoft. Auch die Medizintechnologie spiegelt die futuristischen Visionen aus "Star Trek" wider: In der Serie sah man auf der Krankenstation der "USS Enterprise", wie Doktor McCoy mit seinem Trikorder Schnelltestdiagnosen durchführte und nichtinvasive, schmerzlose Chirurgie praktizierte. Doktor John Adler, Gehirnchirurg des Stanford University Hospital, betrachtet dies rückwirkend als einzig richtigen Weg. Heute sind nichtinvasive Diagnostik, Computertomographie und Magnetresonanztomographie bereits eine Selbstverständlichkeit. Doktor Adler entwickelte darüber hinaus das "Cyberknife", das mit Hilfe computergesteuerter Robotertechnologie Tumore mit einem Laserstrahl entfernen kann, ohne dass ein chirurgischer Schnitt erforderlich ist. Inspiriert zu dieser Entwicklung wurde er von "Star Trek".
(arte)
Länge: ca. 55 min.