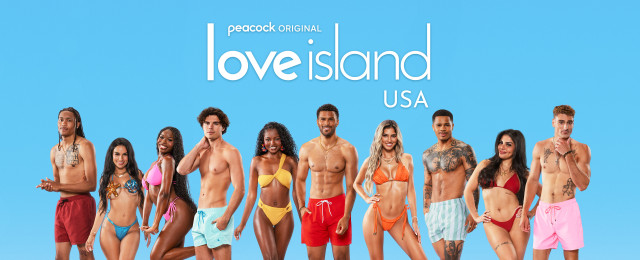Folgeninhalt
Kaum ein Verbrechen der vergangenen Jahre hat die Nation so bewegt wie die Entführung und Ermordung des elfjährigen Bankiersohns Jakob von Metzler. Der Täter: Magnus Gäfgen, 27-jähriger Jurastudent, der sich jahrelang in der katholischen Gemeinde in der Kinder- und Jugendarbeit engagiert hatte, der als höflich und hilfsbereit galt. Wie konnte es dazu kommen, dass dieser überdurchschnittlich intelligente Student ein kleines Kind ermordet - ein Kind, das er kannte? Sechs Jahre danach begibt sich hr-Autor Philipp Engel auf Spurensuche. Gäfgen, aus einfachen Verhältnissen stammend, hatte sich jahrelang vor Freunden als wohlhabender Student ausgegeben, kurz vor einer großen Karriere als Staranwalt stehend. Tatsächlich war er ein durchschnittlicher Student, hielt sich mit Jobs über Wasser und verprasste das Ersparte großspurig. Aus Angst vor dem gesellschaftlichen Offenbarungseid beschloss er, Jakob von Metzler zu entführen, um an Geld zu kommen. Den Tod seines Opfers nimmt er dabei in Kauf. Vor Gericht präsentiert sich Gäfgen selbstmitleidig als einer, der das eigene Verbrechen weder verstehen, noch erklären kann. Das menschlich unerklärliche Verbrechen - eine Deutung, der sich Gäfgens Anwalt Ulrich Endres ebenso anschließt, wie die geladenen Zeugen. Der Film aber zeigt, dass Gäfgen schon früh sozial auffällig war. Eine Frankfurter Familie, bei der Gäfgen zehn Jahre vor dem Mord ein- und ausgegangen war, erzählt, dass er schon damals psychisch schwer auffällig war - ein verhaltensgestörter junger Mann, zwanghaft und penetrant, der um Anerkennung und Hilfe bettelt, der Alarmsignale aussendet, die offensichtlich viele übersehen haben. Der Film beleuchtet auch die so genannte Folterdebatte: Der damalige Frankfurter Polizei-Vizepräsident Wolfgang Daschner hatte dem Tatverdächtigen Gäfgen im Verhör Schmerzen androhen lassen für den Fall, dass er nicht verrät, wo sich das entführte Kind befand. War das Folter? Darf ein Polizist in einer Ausnahmesituation zu solchen Verhörmethoden greifen? Fragen, die die Republik für Wochen beschäftigten. Während die meisten Juristen Daschners Verhalten als völlig inakzeptablen Rechtsbruch geißelten, hat die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung große Sympathie für den Polizeivizepräsidenten. 2004 wurde Daschner zu einer geringen Geldstrafe auf Bewährung verurteilt, wegen Nötigung. Eindringlich lotet die sensible Dokumentation das moralische Dilemma zwischen Folterverbot und Notwehr, zwischen dem rechtsstaatlichen Anspruch des Tatverdächtigen und der Rettung des Opfers aus. Zugleich macht der Film dort weiter, wo die Beweisaufnahme vor Gericht seinerzeit aufgehört hat. Philipp Engel zeigt, dass die Tat eben nicht unerklärlich ist, und wirft die Frage auf, ob sie vielleicht sogar zu verhindern gewesen wäre, wenn die Alarmzeichen rechtzeitig wahrgenommen worden wären.
(hr-fernsehen)