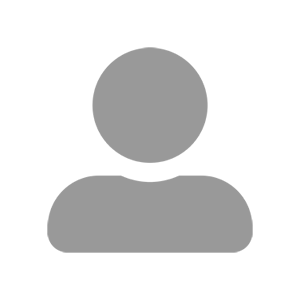Der Ansatz ist, wie stets bei Thomas Bernhard, das tragikomische Paradox zwischen Anspruch und Erfüllung. Ein körperlich fast bis zum Ding reduzierter uralter Mensch hockt da im Sessel: gelähmt, halb taub, einzig durch sein Hörrohr mit der Umwelt verbunden. Er ist nur noch als keifender Haustyrann existent, der bösartig seine alte Frau, die er nie geheiratet hat, herumscheucht. So entwickelt sich das Stück zunächst als höhnisch makabrer Zerrspiegel einer Ehe, die sich in Gewohnheit, Abhängigkeit, Überdruss, zwischen Kartenspiel und kalten Umschlägen verschlissen hat, endlos und unerträglich, bis der Tod sie scheidet. Alles reizt ihn zur Weißglut - das Essen, das geöffnete Fenster, das Fußbad, die Leute und die Erinnerung an sie. "Minetti - wem sonst?" hat der Autor das Stück gewidmet, und so triumphiert die komödiantisch ausgekostete Altersbosheit. Welch ein Vergnügen, einmal Strindbergs Hassspiele mit der polternden Haustyrannenbärbeißigkeit aus "Herr im Haus" gemixt zu sehen. Aber das wäre für Bernhard zuwenig: Wenn er mit Altersschrulligkeiten spielt, tut er es insistierend und zimmert daraus gleich ein hermetisch abgeschlossenes Weltgebäude. Und so sind es keine Schrullen mehr, sondern Erfahrungen und Einbildungen, auf die seine Figuren ausweglos fixiert sind. Der Weltverbesserer hat durch seinen hoch gerühmten, weil wohl unverständlichen Traktat "Über die Verbesserung der Welt" die Ehrendoktorwürde erhalten und erwartet nun die Verleihungszeremonie in seinem Haus. Die umständlichen Vorbereitungen dazu, die Anordnung der Stühle, die Wahl des Anzugs, der sich beim Weltverbesserer mit einer unglücklichen Erinnerung an Trier verbindet, schließlich die Würdigung selbst, die der Geehrte mit ein paar barschen, belanglosen Worten abfertigt - Spiegelbild von Bernhards eigenem berüchtigten Umgang mit Kulturhonoratioren -, diese Stationen gliedern das Stück. Der Traktat zielt auf die Abschaffung der Welt, und eben diese Welt zeichnet den Urheber dafür aus - so wenig hat sie den Text durchschaut. Hätte sie den Weltverbesserer so erkannt, wie er sie sieht, würde sie ihn für verrückt halten. So ist aber die Welt verrückt. Dem Weltverbesserer ist es nicht gelungen, die Welt abzuschaffen, also hat er sich selbst abgeschafft. Wieder spielt Bernhard mit Schlussfolgerungen, die sich gegenseitig aufheben.
(ZDFtheaterkanal)
Schauspielhaus Bochum, 1981
Daten
Länge: ca. 140 min.
| Deutsche TV-Premiere | So, 12.04.1981 (ZDF) |
| Originalsprache: | Deutsch |
Kostenlose Start- und Streambenachrichtigung:
Cast & Crew
![Bernhard Minetti]()
![Edith Heerdegen]()
![Gerd Kunath]()
![Wolfgang Schwalm]()
![Joachim Hermann Luger]()
![Sylvester Schmidt]()
![Franz Xaver Zach]()
![Rupert Johannes Seidl]()
- Regie: Claus Peymann
- Drehbuch: Thomas Bernhard
- Szenenbild: Karl-Ernst Herrmann