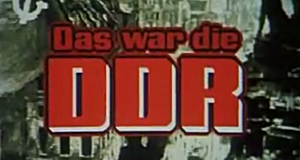Folgeninhalt
"Ich war Bürger der DDR" - das ist der gemeinsame Nenner ungezählter Einzelschicksale und zahlreicher Biographien. Menschen, für die dieser Satz gilt, berichten über Erlebnisse, Gefühle und ihre unterschiedlichen Haltungen zur DDR. Sie äußern sich über das, was die DDR für sie persönlich bedeutete: über alltägliche Versorgungsnöte, verweigerte Reisemöglichkeiten in den Westen, über die Ohnmacht des Einzelnen gegenüber der Allmacht des Staates; aber auch über Hoffnungen, die mit dem sozialistischen Staat auf deutschem Boden verbunden waren. Zeitzeugen geben Einblicke und reflektieren über historische Marksteine der DDR-Geschichte wie den 17. Juni 1953, über Errichtung und Fall der Mauer, über die Niederschlagung des Prager Frühlings 1968, über die Hoffnungen, die an die Perestroika Michail Gorbatschows geknüpft waren.
Der Film stellt die Kardinalfrage, wie sich der Einzelne zum Staat und zur Gesellschaft der DDR stellte. Er forscht nach den Gründen für Engagement, Wohlverhalten, Opportunismus, Gleichgültigkeit, Widerstand oder Flucht. Zu Wort kommen Menschen aus dem Volk: Gymnasiasten der Ossietzky-Schule in Berlin, die 1994 ihr Abitur machten und in der DDR groß wurden; eine junge Friseuse aus Pankow; ein Werftarbeiter in Stralsund, der Opfer der Staatssicherheit wurde, eine Bäuerin in der Altmark; ein ehemaliger Oberstleutnant der Grenztruppen, der heute eine Imbissbude an "seiner Grenze" betreibt; eine Familie, die wegen ihres behinderten Sohnes einen Fluchtversuch unternahm und deshalb unmenschlichen Schikanen ausgesetzt war; Idole wie der Radweltmeister Täve Schur und die Rocksängerin Tamara Danz; aber auch Politiker und Funktionäre wie Karl Schirdewan, Werner Eberlein, Alexander Schalck-Golodkowski oder Egon Krenz. Sie haben das Schicksal der DDR maßgeblich mitbestimmt.
So entstand ein Mosaik aus Gesichtern, Gedanken und Gesprächen - also ein Disput mit filmischen Mitteln, wie er zu DDR-Zeiten wünschenswert und notwendig, so aber nie möglich gewesen wäre.
Der Film stellt die Kardinalfrage, wie sich der Einzelne zum Staat und zur Gesellschaft der DDR stellte. Er forscht nach den Gründen für Engagement, Wohlverhalten, Opportunismus, Gleichgültigkeit, Widerstand oder Flucht. Zu Wort kommen Menschen aus dem Volk: Gymnasiasten der Ossietzky-Schule in Berlin, die 1994 ihr Abitur machten und in der DDR groß wurden; eine junge Friseuse aus Pankow; ein Werftarbeiter in Stralsund, der Opfer der Staatssicherheit wurde, eine Bäuerin in der Altmark; ein ehemaliger Oberstleutnant der Grenztruppen, der heute eine Imbissbude an "seiner Grenze" betreibt; eine Familie, die wegen ihres behinderten Sohnes einen Fluchtversuch unternahm und deshalb unmenschlichen Schikanen ausgesetzt war; Idole wie der Radweltmeister Täve Schur und die Rocksängerin Tamara Danz; aber auch Politiker und Funktionäre wie Karl Schirdewan, Werner Eberlein, Alexander Schalck-Golodkowski oder Egon Krenz. Sie haben das Schicksal der DDR maßgeblich mitbestimmt.
So entstand ein Mosaik aus Gesichtern, Gedanken und Gesprächen - also ein Disput mit filmischen Mitteln, wie er zu DDR-Zeiten wünschenswert und notwendig, so aber nie möglich gewesen wäre.
(MDR)
Länge: ca. 90 min.