Es ist der Winter, in dem die Einen ahnen, dass der Endsieg Propaganda ist und der Frieden fürchterlich wird. Und der Winter, in dem all die Unterdrückten und Verfolgten in Europa endlich Hoffnung schöpfen und eine Befreiung Europas vom Nationalsozialismus plötzlich wieder vorstellbar ist. Die Alliierten sind in Nordafrika gelandet. Die Wehrmacht besetzt daraufhin auch den Süden Frankreichs - eine Defensivreaktion. Der französischen Widerstand, die Résistance, fühlt sich gestärkt, auch die anderen europäischen Widerstandsbewegungen gewinnen an Boden. Hinter der Front und in den KZs läuft die Vernichtungsmaschine weiter. Doch wer als Deutscher noch an das Regime glaubt, muss spätestens im Januar 1943 mit dem Untergang der 6. Armee in Stalingrad einsehen, dass der Krieg verloren ist. Die deutschen Städte sind regelmäßig Ziel nächtlicher Bombenangriffe, die Versorgungslage wird schlechter. In Nordafrika zeichnet sich eine Niederlage der deutschen Truppen ab, im Atlantik fahren immer mehr deutsche U-Boote ihrem Untergang entgegen. Und an dem Februartag 1943, an dem Goebbels in Berlin den Totalen Krieg fordert, werden in München die Geschwister Scholl verhaftet. Sie geben ihr Leben für ein Europa der Freiheit, das in diesem Winter plötzlich wieder möglich erscheint... Vor dem Hintergrund der politischen Ereignisse zwischen November 1942 und Februar 1943 taucht diese Dokumentation ein in die sehr persönlichen Erinnerungen hochkarätiger Zeitzeugen aus acht verschiedenen Ländern Europas und erzählt, woran sie glaubten in diesem Winter 42/43, was sie wussten, ahnten, hofften - in Deutschland, Österreich und Italien, in Frankreich, England und der Sowjetunion, in Ungarn und Polen. Die ungarische Philosophin Agnes Heller, der algerisch-französische Journalist Jean Daniel, Italiens Krimikönig Andrea Camilleri und die kurz nach dem Interview verstorbene Psychoanalytikerin Margarete Mitscherlich liefern ein differenziertes und überraschendes Bild der Atmosphäre in diesen Monaten, als die einen den Glauben an den Sieg verloren und die anderen wieder auf Befreiung hofften. In die filmische Erzählung sind Tagebuch- und Briefauszüge eingewoben, die einen tiefen Eindruck der Gefühlslage der Menschen in dieser Zeit vermitteln. Die Aufzeichnungen des 14-jährigen jüdischen Mädchens Rutka Laskier führen uns in ein Ghetto nach Polen. Der Briefwechsel zwischen der jungen Widerstandskämpferin Sophie Scholl und ihrem Freund Fritz Hartnagel, der als Soldat in Stalingrad kämpft, erzählt von der großen Sehnsucht nach Nähe im Angesicht der schrecklichen Ereignisse. Die Berichte des Schweizer Konsuls Franz Rudolf von Weiss lassen uns teilhaben am langsamen physischen und moralischen Verfall der Menschen in Hitlerdeutschland. Das Tagebuch der Berliner Journalistin Ursula von Kardorff zeigt die Zerrissenheit vieler Deutscher in diesen Monaten der Kriegswende: Die Sehnsucht nach einem Ende des Krieges und das Wissen, das man wird bezahlen müssen für all das, vor dem viele die Augen verschlossen haben. Die Archivmaterialien, die den Film visuell tragen, stammen zu einem großen Teil von Amateuren und sind nicht durch den Blick der Propaganda-Maschine gefiltert. Auch sie geben einen überraschenden Blick auf den Kriegsalltag. So entfaltet sich vor den Augen der Zuschauer ein dichtes, atmosphärisches Panorama der Menschen, ein Bild ihrer Einschätzungen, ihres Alltag, ihrer Gefühlen, ein Eintauchen in den Moment, als noch nicht klar war, wie alles endet. Berührende Erinnerungen an ein und denselben Zeitpunkt aus verschiedensten Perspektiven. Auf diese Weise entsteht ein anderes, ein ungewohnt komplexes Bild von Europa im Krieg: dicht, atmosphärisch, multiperspektivisch, bewegend.
(WDR)
Daten
Länge: ca. 90 min.
| Deutsche TV-Premiere | Mo, 07.01.2013 (Das Erste) |
Kostenlose Start- und Streambenachrichtigung:
Cast & Crew
- Regie: Mathias Haentjes, Nina Koshofer
- Drehbuch: Mathias Haentjes
- Produktion: Gerd Haag, Tag, Traum Filmproduktion
- Musik: Michael Klaukien
- Kamera: Harald Cremer, Torbjörn Karvang
- Schnitt: Volker Gehrke










![[UPDATE] Grimme-Preis 2026: Nominierungen für "Tschappel", "Rosenthal" und "Euphorie"](https://bilder.wunschliste.de/gfx/pics/Grimme-3_757674.jpg)
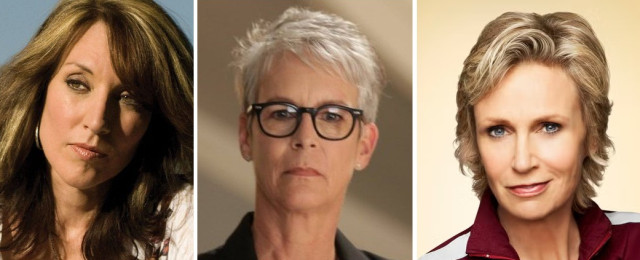
![[UPDATE] "DTF St. Louis": Trailer und Startdatum für schwarzhumorige Serie um tödliche Dreiecksgeschichte](https://bilder.wunschliste.de/gfx/pics/Clark-Jason-Bateman-L-Und-Floyd-David-Harbour-In-Dtf-St-Louis_781034.jpg)
