Folgeninhalt
"Vor allem, was die konkreten Anwendungen angeht, stehen uns in den nächsten zehn Jahren enorme Fortschritte ins Haus", verkündeten elf renommierte deutsche Hirnforscher 2004 in einem Manifest. Darin konkretisierten sie auch ihre Ambitionen: "Wahrscheinlich werden wir die wichtigsten molekularbiologischen und genetischen Grundlagen neurodegenerativer Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson verstehen und diese Leiden schneller erkennen, vielleicht von vornherein verhindern oder zumindest wesentlich besser behandeln können. Ähnliches gilt für einige psychische Krankheiten wie Schizophrenie und Depression. In absehbarer Zeit wird eine neue Generation von Psychopharmaka entwickelt werden, die selektiv und damit hocheffektiv sowie nebenwirkungsarm in bestimmten Hirnregionen an definierten Nervenzellrezeptoren angreift." Heute, zehn Jahre nach dem Manifest, stellt sich die Frage, was aus den Ankündigungen geworden ist. Haben die Neurowissenschaften tatsächlich dazu beigetragen, die erwähnten Krankheiten erfolgreicher zu bekämpfen? Oder handelte es sich bloß um eine geschickte Strategie, die Neurowissenschaften zu einer Leitwissenschaft zu machen? Zweifellos ist im vergangenen Jahrzehnt die Hirnforschung wie kaum ein anderer Wissenschaftszweig subventioniert und mit Forschungsaufträgen bedacht worden. Kritik gab es aber nicht nur wegen der Förderung, sondern auch wegen der vergleichsweise geringen Erfolge. Immer noch fehlt der Gehirnforschung nicht nur die einheitliche Theorie des Bewusstseins, sondern auch das grundlegende Verständnis für die mit Bewusstseinsstörungen verbundenen Erkrankungen. Verschärft hat sich auch die Kritik an den reduktionistischen und deterministischen Vorstellungen der Neurowissenschaften. Die Gesprächssendung "scobel - Das Manifest der Hirnforscher" wird im Rahmen des "NeuroForums 2014" der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung in Frankfurt am Main aufgezeichnet. Dort spricht Gert Scobel mit der Neurobiologin Hannah Monyer, dem Wissenschaftshistoriker Michael Hagner und dem Neurowissenschaftler Wolf Singer über die Grenzen und Möglichkeiten der Hirnforschung.
(3sat)
Länge: ca. 60 min.
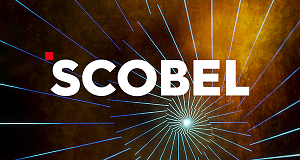


![[UPDATE] "God of War": "Sons of Anarchy"-Star Ryan Hurst übernimmt Hauptrolle in Videospieladaption](https://bilder.wunschliste.de/gfx/pics/Ryan-Hurst-In-Outsiders.jpg)


