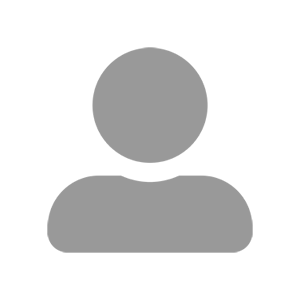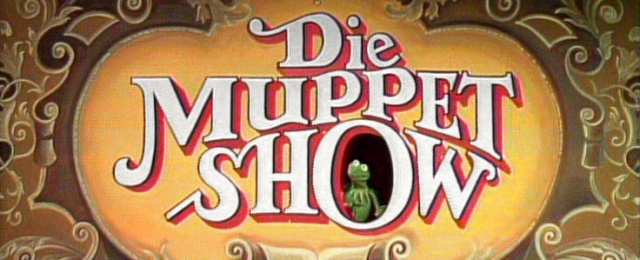Aufzeichnung aus der Konzerthalle „Georg Philipp Telemann“ Magdeburg, 1990.
Die „Brockes-Passion“ ist eines der bedeutendsten Werke Telemanns. Es konnte jedoch nicht der allgemeinen Verurteilung Telemanns als „Vielschreiber“ entgehen und musste 200 Jahre auf eine Wiederaufführung warten.
Das Libretto von Barthold Heinrich Brockes (Erstdruck 1712) war damals ein Bestseller und fand weite Verbreitung als Erbauungsliteratur, besonders im norddeutschen Raum. Zahlreiche Komponisten vertonten es, darunter Reinhard Keiser, Georg Friedrich Händel, Johann Mattheson und Johann Friedrich Fasch. Johann Sebastian Bach verwandte in seiner „Johannes-Passion“ Arien aus dem Libretto von Brockes.
Das Passionsoratorium beginnt mit der Abendmahlsszene und endet mit der Bekehrung des heidnischen Hauptmanns unter dem Kreuz. Dieser Schluss zeigt symptomatisch an, wie sich bei Brockes das Hauptinteresse von der Gestalt Jesu auf die ihn umgebenden oder sein Geschick bedenkenden Menschen verlagert. Telemann benutzt das reiche Instrumentarium, um jeder Arie einen eigenen klanglichen Charakter zu geben. Die Tendenz zur Dramatisierung ist das Hauptkennzeichen der Komposition, das dem Werk zum Teil opernhafte Züge verleiht.
Die „Brockes-Passion“ ist eines der bedeutendsten Werke Telemanns. Es konnte jedoch nicht der allgemeinen Verurteilung Telemanns als „Vielschreiber“ entgehen und musste 200 Jahre auf eine Wiederaufführung warten.
Das Libretto von Barthold Heinrich Brockes (Erstdruck 1712) war damals ein Bestseller und fand weite Verbreitung als Erbauungsliteratur, besonders im norddeutschen Raum. Zahlreiche Komponisten vertonten es, darunter Reinhard Keiser, Georg Friedrich Händel, Johann Mattheson und Johann Friedrich Fasch. Johann Sebastian Bach verwandte in seiner „Johannes-Passion“ Arien aus dem Libretto von Brockes.
Das Passionsoratorium beginnt mit der Abendmahlsszene und endet mit der Bekehrung des heidnischen Hauptmanns unter dem Kreuz. Dieser Schluss zeigt symptomatisch an, wie sich bei Brockes das Hauptinteresse von der Gestalt Jesu auf die ihn umgebenden oder sein Geschick bedenkenden Menschen verlagert. Telemann benutzt das reiche Instrumentarium, um jeder Arie einen eigenen klanglichen Charakter zu geben. Die Tendenz zur Dramatisierung ist das Hauptkennzeichen der Komposition, das dem Werk zum Teil opernhafte Züge verleiht.
(Einsfestival)
Daten
Länge: ca. 143 min.
| Originalsprache: | Deutsch |
Kostenlose Start- und Streambenachrichtigung:
Cast & Crew
![Mária Zádori]()
![Martin Klietmann]()
![István Gáti]()
![Gerd Türk]()
![Ralf Popken]()
![Katalin Farkas]()
![Judith Németh]()
![József Moldvay]()
- Regie: Christa Espey
- Musik: Georg Philipp Telemann
- Dirigent: Nicholas McGegan