Registrierung zur E-Mail-Benachrichtigung
Anmeldung zur kostenlosen Serienstart-Benachrichtigung für
- E-Mail-Adresse
- Für eine vollständige und rechtzeitige Benachrichtigung übernehmen wir keine Garantie.
- Fragen & Antworten
TV-Kritik/Review: Marvel's Jessica Jones
(24.11.2015)

Eine Superheldin außer Dienst, die nach einer Vergewaltigung an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet und trotzdem keine Scheu hat, es in einer Kneipenschlägerei mit einer ganzen Rugby-Mannschaft aufzunehmen: Das ist nicht unbedingt die typischste aller Heldinnen. Auch eine taffe Anwältin, die ihre Ehefrau mit ihrer Assistentin betrügt, würde man auf den allerersten Blick nicht unbedingt in einer Marvel-Comicverfilmung verorten.
So ein Alleinstellungsmerkmal ist durchaus nötig. Denn zwischen all den Filmen und Serien, die da seit Jahren an der großen multimedialen Meta-Mythologie des Comic-Imperiums Marvel stricken, kann man sich inzwischen schon verheddern. Nach all den Einzel- und Sammelfilmen der "Avengers" und "Guardians of the Galaxy" im Kino wird inzwischen auch das Fernsehen mehrgleisig marvelisiert: ABC versorgt die Fans mit
"Jessica Jones" ist nun die zweite dieser Netflix-Einzelserien, und sie ist sogar noch düsterer geraten als "Daredevil". Diese nachtfinstere Weltsicht ist im Comic-Genre seit "Batman Begins" sicher nichts Neues, die konsequente "Hardboiled"-Atmosphäre, die Regisseurin S. J. Clarkson in den ersten Folgen zelebriert, ist das allerdings schon. Dass hinter dem Projekt mit Melissa Rosenberg eine Autorin steht, als deren größter Erfolg die Adaption der blutsaugerromantischen "Twilight"-Schnulzen zu verbuchen ist, mag man fast nicht glauben angesichts der herrlich schroffen No-Nonsense-Attitüde, die Jessica Jones hier vor sich hertragen darf. Und die grenz-soziophobe Protagonistin ist hier nicht die einzige spannende Frauenfigur: Jessicas beste Freundin Trish Walker etwa ist Moderatorin einer Promi-Show im Radio, und Jessicas Auftraggeberin Jeri Hogarth residiert in einem Chef-Büro irgendwo hoch über New York und ist dort, wie beiläufig, die erste (offen) queere Figur im ganzen MCU.
Die Figur Jessica Jones selbst wird vor allem echten Marvel-Checkern etwas sagen: Zwischen 2001 und 2008 war sie die Hauptfigur der Reihen "Alias" und "The Pulse", die sich gezielt an ein erwachsene(re)s Publikum richteten. Die relativ nebulöse Mythologie der Figur ließ Rosenberg viel Spielraum für eine effektvolle Ausgestaltung - ohne dass sie sich dabei weit von den Vorlagen von Brian Michael Bendis und Michael Gaydos entfernen musste. Cover-Zeichner David Mack war sogar in die Gestaltung des Vorspanns involviert, der die Neo-Noir-Atmosphäre der Serie in impressionistisch ineinanderfließenden Zeichnungen zu loungiger Jazzmusik sehenswert vorwegnimmt.
Der nächste Volltreffer ist die Hauptdarstellerin. Krysten Ritter, die in 
Die zentrale Erzählrichtung macht sich dennoch bald bemerkbar: Der routiniert klingende Entführungsfall einer jungen Athletin namens Hope Shlottman (Erin Moriarty) lässt Jessica vermuten, dass jener Mann hinter der Sache stecken könnte, der für ihre psychischen Probleme verantwortlich ist: Kilgrave. Der Mann, der zunächst nur als gruseliger Trauma-Trigger durch Jessicas Tag- und Alpträume huscht, ist ein Gedankenkontrolleur. Einst zog er auch Jessica in seinen Bann - bis es zur Katastrophe kam. Die Visualisierung der Panikattacken, die Jessica überfallen, als sie davon ausgehen muss, dass der Totgeglaubte wahrscheinlich wieder hinter ihr her ist, gehört zum Fesselndsten der ersten Folgen: In verkanteten Perspektiven lässt Regisseurin Clarkson die Bilder violett werden; kurze Schreckeffekte vermitteln die tiefe Verstörung der Protagonistin. Gespielt wird Kilgrave (hinter dem sich, wie Marvel-Kenner wissen, der böse und violette "Purple Man" verbirgt) von David Tennant, dem zehnten
Dass es sich bei Kilgrave um einen Vergewaltiger handelt, wird zunächst nicht ausgesprochen, aber unmissverständlich angedeutet. Überhaupt ist der Umgang mit negativen wie positiven Aspekten der Sexualität in "Jessica Jones" bemerkenswert: Als Jessica etwa mit dem netten Barbesitzer von nebenan Sex hat, fällt der ziemlich ruppig aus. Obwohl sie nicht pornografisch wird (Marvel Entertainment gehört immerhin zu Disney), spielt diese Szene auf eine Weise mit der Vorstellungskraft der Zuschauer, die man im MCU-Rahmen nicht für möglich gehalten hätte. Wie Rosenberg es dabei schafft, Traumatisierung und Vergewaltigung mit sexueller Wiederaneignung und Selbstbehauptung zusammenzuschließen, ohne dass es peinlich oder heikel würde, ist beachtlich. Der Typ, mit dem Jessica da schläft, ist übrigens Luke Cage - auch er eine Marvel-Superheldenfigur und Titelheld der auf "Jessica Jones" folgenden Netflix-Marvel-Serie. Als er und Jessica, die hier als Love Interests gesetzt sind, sich gegenseitig als Superhelden erkennen, säbelt sich Luke zu Demonstrationszwecken mit einer Kreissäge in den Bauch. Ohne Konsequenzen, denn sein Markenzeichen ist seine unverletzbare Haut.
Lukes Darsteller Mike Colter (bekannt aus der CW-Serie
Doch trotz aller Schauwerte und Zwischentöne ist auch "Jessica Jones" nicht völlig makellos geraten. Nach der atmosphärischen Pilotepisode gerät schon die zweite Folge mit viel Standard-Ermittlungsarbeit in deutlich konventionelleres Fahrwasser, einigen Dialogen ist die Sprechblasenherkunft unschön anzumerken, und manche Konstruktion funktionierte im Print-Comic sicher besser als in der Fernsehumsetzung (etwa der ganze Plot um eine Nierentransplantation). Erfrischend ist es allerdings, dass die Serie nicht auf einen typischen "Fall der Woche" für Jessica Jones hinauszulaufen scheint mit - Hope Shlottman, die Gesuchte aus der ersten Folge, spielt weiter eine wichtige Rolle. Und mit Krysten Ritter kann so ohnehin schnell nichts schiefgehen. Sie ist das absolute Zentrum dieser Serie, ihr Charisma trägt "Jessica Jones" mühelos auch über holprigere Passagen. Ihre Jessica ist, so viel ist sicher, eine Fernsehfigur, die bleiben wird.
Dieser Text basiert auf Sichtung der ersten zwei Episoden von "Jessica Jones".
Gian-Philip Andreas
© Alle Bilder: Netflix
Über den Autor
auch interessant
Leserkommentare
Meistgelesene TV-News
- Alles neu bei "DSDS": An diesem Tag startet die 22. Staffel
- "Klein gegen Groß" am 7. März 2026: Das sind die prominenten Gäste und Duelle
- "Sullivan's Crossing": Scott Patterson bestätigt Ausstieg, beschwert sich über Fehlinformationen
- Schlagerstar Melissa Naschenweng: An diesem Tag läuft ihr erster Film "Herzklang - Zurück zu mir"
- "Navy CIS", "Navy CIS: Origins" und "FBI": Ab diesem Tag zeigt Sat.1 neue Folgen
Neueste Meldungen
![[UPDATE] "From": Startdatum und Teaser für Staffel 4 der gruseligen Hitserie veröffentlicht](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 640 260'%3E%3C/svg%3E) Update "From": Startdatum und Teaser für Staffel 4 der gruseligen Hitserie veröffentlicht
Update "From": Startdatum und Teaser für Staffel 4 der gruseligen Hitserie veröffentlicht BBC-Historiendrama "Howards End" mit "Marvel's Agent Carter"-Star kommt endlich ins Free-TV
BBC-Historiendrama "Howards End" mit "Marvel's Agent Carter"-Star kommt endlich ins Free-TV![[UPDATE] "Only Margo" mit Michelle Pfeiffer und Nicole Kidman: Ausführlicher Trailer und Starttermin zur neuen Familien-Dramedy](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 640 260'%3E%3C/svg%3E) Update "Only Margo" mit Michelle Pfeiffer und Nicole Kidman: Ausführlicher Trailer und Starttermin zur neuen Familien-Dramedy
Update "Only Margo" mit Michelle Pfeiffer und Nicole Kidman: Ausführlicher Trailer und Starttermin zur neuen Familien-Dramedy "Wieder Alle Jahre wieder": Erfolgreiche ARD-Weihnachtskomödie erhält Fortsetzung
"Wieder Alle Jahre wieder": Erfolgreiche ARD-Weihnachtskomödie erhält Fortsetzung
Specials
 "CIA": Der Spion und der Erbsenzähler
"CIA": Der Spion und der Erbsenzähler Die 11 wichtigsten Serien im März
Die 11 wichtigsten Serien im März "Let's Dance"-Start der 19. Staffel: Alle Stars, Sendetermine und Infos im Überblick
"Let's Dance"-Start der 19. Staffel: Alle Stars, Sendetermine und Infos im Überblick In "Kacken an der Havel" fällt Rapper Fatoni in komische Geschichte für Netflix
In "Kacken an der Havel" fällt Rapper Fatoni in komische Geschichte für Netflix Die neuen Serien 2026: Von Crime bis Comedy, von Sci-Fi bis Mystery
Die neuen Serien 2026: Von Crime bis Comedy, von Sci-Fi bis Mystery Die 30 kultigsten Zeichentrick-Intros aller Zeiten
Die 30 kultigsten Zeichentrick-Intros aller Zeiten 30 Jahre Super RTL: Wo ist der Zauber von damals geblieben?
30 Jahre Super RTL: Wo ist der Zauber von damals geblieben?
Neue Trailer
![[UPDATE] "Your Friends & Neighbors": James Marsden macht Jon Hamm in Staffel 2 Schwierigkeiten](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 640 260'%3E%3C/svg%3E) Update "Your Friends & Neighbors": James Marsden macht Jon Hamm in Staffel 2 Schwierigkeiten
Update "Your Friends & Neighbors": James Marsden macht Jon Hamm in Staffel 2 Schwierigkeiten "Beef": Neuer Ärger kündigt sich in Staffel 2 mit Oscar Isaac und Carey Mulligan an
"Beef": Neuer Ärger kündigt sich in Staffel 2 mit Oscar Isaac und Carey Mulligan an![[UPDATE] "The Boys": Ausführlicher Trailer zur finalen Staffel](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 640 260'%3E%3C/svg%3E) Update "The Boys": Ausführlicher Trailer zur finalen Staffel
Update "The Boys": Ausführlicher Trailer zur finalen Staffel![[UPDATE] "The Handmaid's Tale"-Sequel: Starttermin und Trailer für "The Testaments: Die Zeuginnen"](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 640 260'%3E%3C/svg%3E) Update "The Handmaid's Tale"-Sequel: Starttermin und Trailer für "The Testaments: Die Zeuginnen"
Update "The Handmaid's Tale"-Sequel: Starttermin und Trailer für "The Testaments: Die Zeuginnen" "Lanterns": Erster Teaser-Trailer zur DC-Superheldenserie kreist Startdatum ein
"Lanterns": Erster Teaser-Trailer zur DC-Superheldenserie kreist Startdatum ein
Die Vorschau - Unser neuer Podcast










![[UPDATE] "From": Startdatum und Teaser für Staffel 4 der gruseligen Hitserie veröffentlicht](https://bilder.wunschliste.de/gfx/pics/From-2.jpg)

![[UPDATE] "Only Margo" mit Michelle Pfeiffer und Nicole Kidman: Ausführlicher Trailer und Starttermin zur neuen Familien-Dramedy](https://bilder.wunschliste.de/gfx/pics/Michelle-Pfeiffer-Und-Elle-Fanning-Als-Mutter-Tochter-Gespann-In-Only-Margo.jpg)


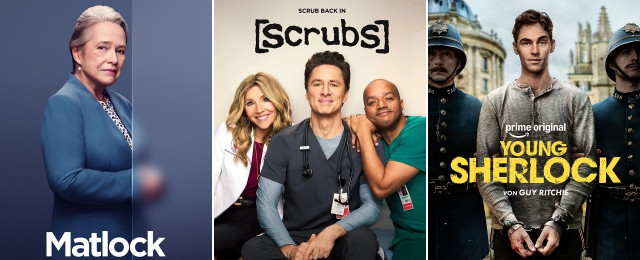





![[UPDATE] "Your Friends & Neighbors": James Marsden macht Jon Hamm in Staffel 2 Schwierigkeiten](https://bilder.wunschliste.de/gfx/pics/Jon-Hamm-Als-Andrew-Coop-Cooper-In-Your-Friends-Neighbors.jpg)

![[UPDATE] "The Boys": Ausführlicher Trailer zur finalen Staffel](https://bilder.wunschliste.de/gfx/pics/The-Boys-Starten-Im-Kommenden-Monat-In-Die-Dritte-Staffel.jpg)
![[UPDATE] "The Handmaid's Tale"-Sequel: Starttermin und Trailer für "The Testaments: Die Zeuginnen"](https://bilder.wunschliste.de/gfx/pics/The-Testaments-Die-Zeuginnen_282239.jpg)
